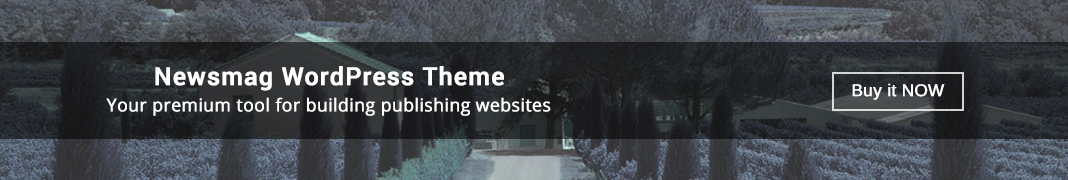Must Read
Österreich: Wipfel, Täler, Bähnlein
Österreich ist bekannt für seine malerischen Landschaften und idyllischen Orte. Eine unbekannte aber nicht minder atemberaubende Region findet man inmitten der Alpen, den Lungau...
Die...
Wall Street: Von der Andacht bis Zocken
Anzugträger, Dreiteiler, Windsor-Knoten. In die Trinity Kirche gleich gegenüber der Wall Street kommen seit der Finanzkrise, Herbst 2008, dreimal so viele Besucher. Touristen ebenso. Aber zum Schnappschuss am kupfernen Bullen...
Bregenz: Bühne mit Riesen-Badewanne
Parkplätze gibt es kaum noch, fast 7.000 Sitzplätze sind belegt, Fotoapparate gezückt. Dann geht es los, das Spektakel. Eine Mischung aus Oper, Musical und...
Kenia: Schulbau mit Hindernissen
Kimilili ist ein kleines Dorf im Zentrum Kenias, nur schwer zugänglich und für Touristen gibt es nichts zu sehen. Aber Kimilili ist eine Reise wert, sie kann Leben verändern. Astrid Kühne begleitet den Bau einer Schule…
Südafrika: Am Cup der guten Hoffnung
An Kapstadts Molen flanieren, hinauf zum Tafelberg oder gleich an der Gardenroute entlang. Südafrika hat wunderschöne Seiten, zum Reisen. Aber auch zum Arbeiten. Spannende...
Insel-Hopping: Um den Globus radeln
Insel-Hopping kombiniert das Erkunden von fernen Küsten und Inseln per Pedal mit dem Kreuzfahrterlebnis. Angefangen hat diese Form des Urlaubmachens in Kroatien...
Peter Eich und...
Vatikan: Alles von Archiv bis Popkonzert
„Wir sind Papst“, schallte es vor sechs Jahren durch den Blätterwald, nicht nur die BILD. Evangelische Studenten haben Papst Benedikt XVI. nach seiner Wahl besucht...
Bolivien: Rekordhalter mitten in Südamerika
Vielfach als "Tibet" Südamerikas beschrieben, wartet Bolivien mit einigen Rekorden auf: Dem größten Bergsee, der höchsten Haupstadt, der weitesten Salzwüste der Welt. Im ärmsten...
Popular Destinations
Myanmar/ Burma: Hoffen aufs erste Auto, Bildung – und eigene Coca-Cola
Pagoden, Klosterleben und Ochsenkarren. Das Land mit unzähligen, tausenden Pagoden zwischen Bangladesch und Laos, Thailand und Indien hat mehr zu bieten. Erst kamen die...
Philippinen: Was geschah wirklich am Mayon-Vulkan?
Er gilt vielen als der schönste Vulkan der Welt, der Mayon auf den Philippinen. Am 7. Mai 2013 kamen jedoch fünf Kletterer, drei Deutsche...
China: 1,3 Milliarden, Menschen, Mandarin
China wandelt sich. Und damit auch so manche Klischees, die wir als Touristen mit dem Riesenland im fernen Osten verbinden. 6 Streifzüge von der...
St. Gallen: Stift mit Seelenapotheke
Der St.Galler Stiftsbezirk gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Wir haben uns in einem der ältesten Kloster der Welt mal umgeschaut - und dabei manch interessanten Plan entdeckt....
Indien: Reise zu den Ex-Kopfjägern im Nordosten Indiens
Imphal ist die Hauptstadt von Manipur, einer der sieben Schwesterstaaten in Nordost Indien. Nordost Indien ist nur durch einen schmalen Korridor mit Ost-Indien verbunden...
Bangkok: Khao San, Klongs und Tuk-Tuk-Konzerte
Bangkok ist das Gesicht des "Tigers" Südostasiens und bietet (fast) schon westliche Infrastruktur. Zu den Traumstränden a la "The Beach" ist es eine Flugstunde,...